|
Seit der festlichen Weihe des restaurierten Domes
am Ansverus-Tag, den 15. Juli 1966, sahen viele Menschen das
Gotteshaus, nahmen teil am Gottesdienst, an Morgenandachten und an
abendlichen Chor- und Orgelkonzerten und spürten im Denken und in
Andacht die Strahlungskraft dieses Bauwerks, das nun in der
wiederhergestellten "Urfassung" zu uns spricht. Es ist beglückend,
diese Menschen über ihre Eindrücke sprechen zu hören. Aus zwei in
jüngster Zeit an Domprobst Dr. Groß gerichteten Briefen
1) seien
einige Sätze als Beispiel dafür wiedergegeben: ". . . Noch nie hat
ein Raum so stark auf meine Augen und mein Gefühl eingewirkt wie
dieser, in dem wir einander begegnet sind, kleine Menschen, doch
einbezogen in die Größe, die hier wohnt, in die Würde, die sonst
überall zerbricht, in den Ernst, den das einfallende Licht so
ergreifend heiter stimmt. Es ist ein wohnliches Haus, trotz seiner
Strenge, und sein Geist kann Menschen verwandeln . . ." ". . . Mein
Verhältnis zu Ihrem Dom wurde schon in meiner Jugend begründet. Doch
nie war ich so ergriffen, überwältigt und erhoben wie dieses Mal.
... Es ist so gar keine kirchliche Eitelkeit in diesem Haus! Es ist
in ihm alles, was uns Menschen fehlt: Größe, Strenge, Reinheit,
Einfachheit, Würde, Herrlichkeit..."
Eine wundervolle Aufgabe war es, aus den "verhüllenden Umwandlungen
des 19. Jahrhunderts", aber auch der Jahrhunderte davor, "den
ursprünglichen Kern herauszuschälen" (Peter Hirschfeld), also bis
zur "Urfassung" vorzustoßen. Ich habe es mir nun zum Ziele gesetzt,
auch in den Randbereichen neben dem Dominnern, also in der
Vorhalle, Sakristei, im Kapitelsaal, Archivraum, im Kreuzgang und am
Äußeren des Gotteshauses an der Südfront der Vorhalle, am Turm, an
den beiden Nebenapsiden und an seinen Ausstattungsstücken, wie z. B.
am spätgotischen Wandelaltar und den mittelalterlichen
Holzschnitzwerken, Schicksalsspuren abzulesen und sie bis zu ihren
Anfängen zurückzuverfolgen. Die Arbeit wird freilich dadurch
erschwert, daß wesentliche Bauurkunden weder vorhanden, noch
erreichbar sind. Aber wer mit seinen Mitarbeitern während der Jahre
1960 bis 1966 und auch schon vorher seit 1952 mit offenen Augen und
empfänglichem Sinn den Dingen um dieses Gotteshaus nahe war, dem
erschließen sich auch Quellen, die zu Erkenntnissen führen.
In lockerer Folge soll hier darüber berichtet werden. Ich möchte
zuerst einiges über die Vorhalle, dann über den Turmbau,
anschließend über die Nebenapsiden und den gotischen
Wandelaltar
mitteilen.
Die Vorhalle
Mit dem Bau der Eingangshalle um 1220 war der Ratzeburger Dom nach
einer Bauzeit von einem halben Jahrhundert im wesentlichen
abgeschlossen. Erst 1251 begann man mit dem Bau des Ostflügels der
Klausurgebäude. Die Vorhalle, das "reizvollste und am meisten
durchgestaltete Baugebilde sowohl im Äußeren als auch im Inneren,
das wir am Ratzeburger Dom antreffen, eine Spitzenleistung des
frühen Backsteinbaue;, überhaupt" (Kamphausen), ist ursprünglich
eine Marienkapelle gewesen. Heinrich der Löwe hatte gelobt
2), den
Dom zu Ehren der
____________________
1) Erich Lüth, ehemaliger Pressechef des Hamburger Senats.
2) von Notz, Seite 20. Vgl. auch Zehntenregister. Meckl.
Urkundenbuch I. Band 786-1250, Schwerin 1863, Seite 377 in Nr. 375:
"Hanc liberam cum omni iure dux Heinricus contulit Raceburgensi
episcopo, quia, cum primum intraret terram cum exercitu, prima
[nocte] quievit ibi, et hoc primum sacrificium fecit deo et beate
Marie."
Lbg. Heimat NF 64, Seite 10
Lbg. Heimat NF 64, Seite 11
Mutter Gottes zu stiften. Geweiht wurde er, der ja fast zu gleicher
Zeit mit den Domen in Lübeck und Braunschweig errichtet wurde, der
Jungfrau Maria und dem Apostel Johannes. Ihre Bilder, vor die
Rückwände mit dem byzantinischen Muschelnimbus gestellt, stehen
unter dem großen Triumphkreuz als älteste Zeugnisse bildnerischen
Schmuckes, den der Dom trotz mancher Plünderung über die Zeiten
gerettet hat. Um 1260 mögen sie entstanden sein.
Die Gottesmutter genoß höchste Verehrung. Es ist durchaus möglich,
daß der Dom in ältester Zeit nach ihr seinen Namen führte. In einer
Urkunde von 1261 wird er "ecclesia sanctae Mariae in Raceburg"
3)
genannt. Von 1210 stammt das älteste uns erhaltene Kirchensiegel. Es
trägt die Umschrift "SIGILLU SANCTE MARIE VIRGINIS IN RACEBURG +"
4)
und zeigt im Bild Maria mit dem Kind. In der zweiten Hälfte des 15.
Jahrhunderts besitzt der Dom zwei holzgeschnitzte Bildwerke der
Madonna, das eine von dem Lübecker Bildschnitzer Johannes Stenrat,
etwa 1470, das zweite von dem Lübecker Bildschnitzer und Maler Hans
Hesse, etwa 1440 entstanden, dazu eine Pieta von Johannes
Stenrat,
auch aus der Zeit um 1470 5). Es kann mit Sicherheit angenommen
werden, daß die "schöne Madonna" von Hans Hesse den Marienaltar in
der (damals noch fensterlosen) Altarnische der Vorhalle zierte. Ihr
späteres Schicksal war betrüblich: Entweder bei der großen
Domplünderung am 23. Mai 1552 oder zur Reformationszeit zwischen
1564 und 1574 - "nach Abschaffung der Abgötterei in der Domkirche .
. ." 6), zur Zeit der Bilderstürmer oder gar spätestens nach 1648,
als das letzte Domkapitel eine Neuausstattung des Domes vornahm,
sind die Schnitzwerke aus dem Dominnern entfernt worden. Auf den
Domböden, im Schulsaal und in der Dombibliothek lagen sie, arg
verstümmelt, lange unbeachtet herum. Mit Zustimmung des
Oberkirchenrats und des Landesmuseums in Neustrelitz wurden sie im
April 1925 von dem damals amtierenden Domprobst für 1500 M an das
Museum für Kunst und Gewerbe nach Hamburg verkauft. Für den Erlös
dieser "Figurenreste" wurden Glocken für den Dom angeschafft. Am 7.
Juli 1966, genau acht Tage vor der Domweihe, konnten wir dank der
Freundlichkeit von Frau Prof. Dr. L. L. Möller, Hamburg, eine der
beiden Madonnen und die Pietà-Gruppe im Ratzeburger Dom wieder
aufstellen. Die "schöne Madonna" von Hans Hesse aus dem Kreise des
Meisters der Darsow-Madonna, die beim Luftangriff in der Lübecker
Marienkirche verglühte, ist leider noch ausgestellt im Hamburger
Museum (Abb. 1). Aber die Hoffnung, daß sie einst den Weg zurück
nach Ratzeburg finden wird, bleibt uns. Der Schmerzensmann,
ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert, entging dem Schicksal der
Veräußerung. Er lag verstümmelt, vergessen und unbeachtet in einem
der Turmgeschosse. Jetzt ist er zur Mitte der Gefallenenehrung in
der südlichen Nebenapside geworden.
Wir können nicht mit Sicherheit rekonstruieren, wie die
Marienkapelle nach der Einführung der Reformation (1564) genutzt
wurde. Nach einem Bericht von Uffenheim aus dem Jahre 1709 stand
dort "ein verguldeter Wagen, selbiger siehet sehr alt und wunderlich
von Form aus". Damit verträgt sich schlecht die Bemerkung im Buch
von Notz, Seite 92, wonach dieser "jahrhundertelang ... in des Domes
Eingangshalle" gestanden habe. Allenfalls könnte dies für die Zeit
nach 1564 zutreffen. Noch 1509 wird unter Bischof Johannes von
Parkentin ein Beneficium "am Altar der heil. Maria in dem Eingang
der Domkirche" gestiftet 7), und
____________________
3) von Notz, Seite 20.
4) Kunst- und Geschichtsdenkmäler des Freistaates Meckl.-Strelitz,
"Das Land Ratzeburg, Geschichtliche Einleitung", Seite 20.
5) Nordelbingen 7. Band, 1928.
6) Masch, Seite 514.
7) Masch, Seite 380.
Lbg. Heimat NF 64, Seite 11
Lbg. Heimat NF 64, Seite 12
in die Eidesformel der Bischöfe wurde noch 1501 die Verpflichtung
aufgenommen, "den Mariendienst aufrecht zu erhalten"
8). Die
Marienverehrung stand also in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts
in hoher Blüte. Es ist nicht denkbar, daß ein Kultraum wie die
Marienkapelle durch die Abstellung eines "verguldeten Wagens"
entweiht wurde, selbst wenn dieser "für Prozessionen, Umzüge oder
auch zur Einholung der Bischöfe" verwendet worden sein dürfte.

Abb. 1
Im Buch "Kunst- und Geschichts-Denkmäler des Freistaates
Mecklenburg-Strelitz", dessen Teil "Der Dom zu Ratzeburg" Prof. D.
Dr. Richard Haupt bearbeitete, finden wir auf Seite 55 eine Aufnahme
der Staatlichen Bildstelle Berlin von der Südseite des Domes vor
1874 (Abb. 2). An dieser soll uns jetzt nur die Ansicht des
Vorhallengiebels interessieren. Sie zeigt unter dem prachtvollen
Giebeldreieck zwei Portale. Das vom Beschauer linke (westliche)
sitzt in einer etwa 15 cm vorspringenden, aus dem Sockel
hochgezogenen Mauervorlage. Deren Randprofile sind die umgebrochenen
Sockelprofile. Das rechte (östliche) Portal hat weder die
Wandverdickung nach außen, noch das umlaufende Randprofil. Im
Grundriß sitzt es nicht in einem Wandfeld, das wie beim Westportal,
wegen der Türleibung und
____________________
8) von Notz, Seite 21.
Lbg. Heimat NF 64, Seite 12
Lbg. Heimat NF 64, Seite 13

Abb. 2
Foto: Staatliche Bildstelle Berlin (1874)
Das zweite Portal in der Südvorhalle ist nicht original, es wurde im
Jahre 1835 zur Unterstellung der Feuerspritze eingebrochen und bei
der Restaurierung von 1876-81 wieder
entfernt.
Lbg. Heimat NF 64, Seite 13
Lbg. Heimat NF 64, Seite 14
wie bei der ins Mauerwerk eingearbeiteten Apsisnische um über 30 cm
nach innen vorgezogen ist. Es hat die gleiche Wanddicke wie die
beiden Felder der Westfront und das südliche Feld der Ostfront von
etwa 1,20 m, kann also ursprünglich nicht für den notwendig tiefen
Anschlag von Portaltorflügeln gedacht gewesen sein.
Ich habe mich lange gegen diese Erkenntnis und die daraus
abzuleitende Schlußfolgerung gesträubt, daß wir es hier nicht mit
einem "Paradies" mit zwei offenen Portalen zu tun haben, und daß aus
diesem Grunde dieses rechte Portal nicht ursprünglich sein könne.
Eine unerwartete Entdeckung im Domarchiv vor Jahresfrist bestätigte
aber diese Vermutung.
Bei den fast sechs Jahre währenden Restaurierungsarbeiten im
Dominnern konnten wir leider nicht auf Bauakten aus älterer Zeit
zurückgreifen. In den Dom-Archivbeständen in Ratzeburg war davon
nichts vorhanden. Und wir mußten uns mit der wohl zutreffenden
Vermutung zufrieden geben, daß solche Unterlagen vor dem zweiten
Weltkrieg nach Schwerin oder in das Landesarchiv nach Neustrelitz
abgegeben wurden. Um so erfreuter waren wir, wenn uns eigene
Nachforschungen zu klärenden Erkenntnissen verhalfen. Vor
Jahresfrist, am 7. März, entdeckte ich in den Archivbeständen eine
gebündelte Akte über die "Domfeuerspritze". Daß sich dabei auch
einiges fand, was mir zur Aufhellung über die "Vorhalle" verhalf,
war wohl nicht zu erwarten, traf aber zu.
Einen mit "Bau-Mängel" überschriebenen "Anschlag über Materialien u.
Kosten" vom Februar 1835 legt Maurermeister A. Spolert,
"Domhof bey
Ratzeburg, zur Einrichtung eines Lokals, für der Feuersprütze an der
Domkirche, welche VORN in den Materialien-Magazin, am Eingang in der
Kirche stehen soll" . . . vor. "Durch der Maßiven Mauer, welche 3
Fuß stark ist, eine 2flügeligte Thür anzubringen mit Oberfenster"
heißt es darin u. a. Es folgen Beschreibung und Veranschlagung von
zusätzlichen Arbeiten des Zimmermanns wie "Bretterverschläge
wegzunehmen und an einer andern Stelle aufzusetzen, an der
Eingangsthür, in der Kirche, ist eine Holzwand mit Fachwerk
hinzusetzen, . . . nach der Ostseite den Fußboden neu zu legen, und
1 1/2 Fuß zu verhöhen wegen der Ausfahrt." Etwas deutlicher werden
Befund und geplante Bauarbeiten beschrieben in einem "Actum auf dem
Domhofe in Großherzoglicher Consistorial-Commission des Fürstenthums
Ratzeburg, den 19. August 1835 in Gegenwart: des Herrn Probst
Genzken und des Herrn Gerichts-Raths Dr. Karsten." Zusammen mit
Steuer-Commissair Wentzel wurde "zum Zweck der Einnahme des
Augenscheins wegen der bereits reparirten, bei der Domkirche
befindlichen Feuerspritze und der damit in Verbindung stehenden
Feuerlöschungs-Anstalten .. ." ein Ortstermin abgehalten. Man hatte
sich überzeugt, "daß der jetzige Aufbewahrungsort der Feuerspritze
der Bestimmung derselben ganz unangemessen und ihrer Translocation
in die Materialien-Kammer der Kirche neben der Kirchenthüre
unumgänglich sey, wobei das große Kirchenfenster zur Einrichtung
einer Thür zu benutzen, und auf solche Weise diese Einrichtung mit
einem Aufwände von etwa 70 bis 80 Rthl errichtet werden mögte." Vom
29. Januar 1836 ist diesem Vorgange ein Promemoria, nach unserem
Sprachgebrauch ein Aktenvermerk, beigefügt, den Domprobst Genzken
angefertigt und unterschrieben hat. Darin wird abschließend
bestätigt, daß "das zur Aufbewahrung der Domfeuerspritze neu
eingerichtete Local vollendet" und die völlig instandgesetzte
Spritze dorthin geschafft worden sei. Alles wurde in guter Ordnung
vorgefunden.
Aus der Marienkapelle von 1220 war also eine Materialienkammer
9)
geworden, die zudem durch Bretterverschläge unterteilt gewesen sein
muß. Etwa im letzten Drittel des Jahres 1835 wurde das zweite Portal
eingebrochen, durch eine hölzerne Fachwerkwand auf die Mittelsäule
zu die Vorhalle unterteilt und ein Holzfußboden mit Gefälle nach
außen angelegt. Jetzt blieb der Westteil mit altem
____________________
9) Chronik der Stadt Ratzeburg, Seite 87: ". . . In die südliche
Vorhalle führten z. B. zwei ungleich hohe und breite Pforten
nebeneinander und ein Teil der Marienkapelle war zur Rumpelkammer
eingerichtet, in welcher unter anderm ein alter vergoldeter Wagen
gestanden hatte . . ."
Lbg. Heimat NF 64, Seite 14
Lbg. Heimat NF 64, Seite 15
Portal Durchgang zum Dom, der Ostteil wurde zum "Local" für die
Domfeuerspritze abgewertet. Von dieser Veränderung, die sich bis zur
Restaurierung von 1876-81 erhalten hatte, war ich vor Jahren durch
Domküster Moldenhauer unterrichtet worden, der von seinem
Amtsvorgänger d'Ottilie davon erfahren hatte. Aber verläßliche
Nachrichten waren unbekannt. In keinem der bau- und
kunstgeschichtlichen Werke über den Ratzeburger Dom ist darüber
etwas zu finden. Nur Architekt J. F. Lauenburg, Hamburg, teilt im
Anhang zu G. M. C. Masch: "Geschichte des Bisthums Ratzeburg",
Lübeck 1835, einiges, was hier interessiert und was bisher wohl
übersehen wurde, auf Seite 748 mit. Nach seiner Überzeugung scheint
der Dom "in seiner ursprünglichen Gestalt bis zum Anfang des 15.
Sec. erhalten worden zu seyn; da erlitt die Kirche jenen bedeutenden
Umbau, dem sie ihre heutige Form verdankt". Er meint damit die
Anlage von Seitenkapellen nach Nord und Süd wie wohl gleichzeitig
beim Lübecker Dom: "Man durchbrach die äußern Wände der
Seitenschiffe so stark, als es eben der alte Bau gestattete, und
fügte diesen Oeffnungen die verlangten Capellenartigen Räume hinzu;
die Seitenbegränzung der Kirche wurde also hinaus gerückt und die
alte Seitenmauer durch die Dachung der Capellen versteckt... In die
Zeit dieses Umbaues fällt aller Wahrscheinlichkeit nach die Erbauung
des Thurmes, die Anlage des großen Fensters am westlichen Ende der
Kirche, das Fenster in der südlichen Eingangshalle und die
Vergrößerung der Schlußcapelle der Seitenschiffe. - Der südliche Arm
des Kreuzes verlor durch Einbrechung eines großen spitzbogigen
Fensters, anstatt zweier durch Rundbogen geschloßener Fenster, (am
nördl. Kreuzesarm sind sie erhalten,) . . . seine ursprüngliche Form
..." Zum Glück berichtete uns Architekt Lauenburg vor 1835. Er
kannte also noch den Zustand, bevor Ende 1835 das zweite Portal für
die Feuerspritze eingebrochen wurde.
Über einen dritten Beleg, wie die Südwand der "Vorhalle" vor 1835
aussah, unterrichtete mich Domprobst Dr. Groß am 14.
8. 68. Es existiert ein Modell des Domes aus dem Jahr 1833.
Vermutlich befindet es sich heute in Schwerin oder Neustrelitz. Der
Verfasser der kleinen, aber sehr inhalt- und aufschlußreichen
Schrift von 1932, Ferdinand von Notz, hat dieses Modell gekannt und
von ihm am 10. 5. 1933 einfache Handskizzen angefertigt, die sich in
seinem Nachlaß fanden (Abb. 3). Über der Südansicht des Domes mit
der Vorhalle steht sein hand-
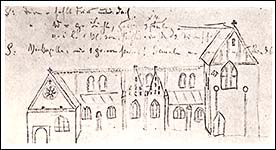
Abb. 3
Lbg. Heimat NF 64, Seite 15
Lbg. Heimat NF 64, Seite 16
schriftlicher Vermerk: "S: Vorkapelle
10): nur 1 gr. rom. Portal!
Daneben ein gr. plumpes Rundbogenfenster." Überschrift zu den
Skizzen: "Nach dem Neustrelitzer Dom Model v. 1833 (von Reiche)
11),
Neustrelitz 10. 5. 1933. von Notz."
Einen vierten Beleg liefert uns der bei Richard Haupt in seinem Buch
"Die ältesten Dome und ihre Anfänge im Bereiche der deutschen
Nordmark", 1936, Westholsteinische Verlagsanstalt, Heide in
Holstein, auf Seite 31 gezeigte Grundriß (Abb. 4). Haupt hat ihn
wohl schon früher (1925) im 6. Band seines Werkes über: "Die Bau-
und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein bzw. Geschichte
und Art der Baukunst in Nordelbingen", Heide in Holstein, 1925,
veröffentlicht. Von dort übernahm ihn von Notz in sein Buch
"Der Dom
zu Ratzeburg", Ratzeburg 1932, Seite 12, mit der Unterschrift
"Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880 (aus Haupt, 6. Bd.)".
Dieser Grundriß zeigt den Bauzustand des Domes, wie er vom Beginn
des 15. Jahrhunderts an bis zum Einbruch des zweiten Portals in die
Vorhalle (1835) bestanden hat! Die hier dargestellte
Mauerwerköffnung ist NICHT das zweite Portal, sondern das "große
plumpe Rundbogenfenster", das von Notz nach dem Modell von
Reiche
skizziert hat und das hier, wie es bei Fensteröffnungen im Grundriß
üblich ist, mit den oberhalb der Schnittlinie in der Waagerechten
verlaufenden Profillinien - hier der "plumpe" Spitzbogen -
dargestellt ist. Das links danebenliegende echte Portal wie alle bis
zum Fußboden offenen Tür-, Tor- und Mauerwerköffnungen bleibt auch
in diesem Grundriß offen. Es ist für mich kein Zweifel, daß von
Reiche sein Dommodell im Jahre 1833 nach diesem Grundriß angefertigt
hat. Er zeigt die Fünfschiffigkeit, die durch den Anbau der
Seitenkapellen nach N und S entstanden war, aber auch, daß die
Apsisnische in der Vorhalle noch kein Fenster hatte, während man zur
Sakristei noch durch das alte, von uns im Jahre 1963 wieder
freigelegte romanische Portal von der nördlichen Nebenapside aus
ging, das Daniel zumauern, dafür aber einen Zugang vom nördlichen
Querhausquadrat einbrechen ließ. Den haben wir dann wieder
zugemauert und mit einer großen Grabplatte verschlossen!
Die baulichen Veränderungen auf der Südseite des Domes, die ja seine
Schauseite ist, sollen nun kurz zusammengefaßt werden: Nachdem die
Marienkapelle (Vorhalle) um 1220 vollendet war, begann nach etwa 150
Jahren um 1370/80 unter Bischof Heinrich von Wittorp der Bau der
Katharinenkapelle 12) durch Herzog Erich von Sachsen, die spätere
Grabkapelle der Lauenburger Herzöge, darum auch "Lauenburger
Chorkapelle" genannt. Sie erhielt zwei große, gedrückt spitzbogige,
dreiteilige gotische Fenster. Kurz darauf, wohl ab 1401, wurden die
beiden Reihen der Seitenschiffkapellen nach Nord und Süd angelegt
und deren breite Fensteröffnungen mit Segmentbögen geschlossen. In
der Oberwand des Querhauses saß ursprünglich ein schlankes
romanisches Fensterpaar, das den im Obergaden nach Nord und Süd und
den im Querhaus sitzenden glich. Jetzt folgte man dem
Gestaltungswillen der gotischen Zeit, die an der Südfront der
romanischen Gotteshäuser gern die Fenster vergrößerte und vermehrte:
Man schuf ein großes, stumpfspitzbogiges, plumpes fünfteiliges
Fenster, das ebenso breit war wie die beiden ursprünglichen
zusammen, und führte es über die Zone des waagerechten
Kreuzbogenfrieses bis in den Fries der Stromschichten hinein. Von
ähnlicher Art, maßstäblich natürlich kleiner, mag "das große, plumpe
Rundbogenfenster" gewe-
____________________
10) Es ist nicht mit letzter Sicherheit anzugeben, ob es hier "Vor .
." oder "Mar . ." (Marien)kapelle heißt.
11) In der "Chronik der Sadt Ratzeburg" von Prof. Dr. L. Hellwig,
Lauenburgischer Heimatverlag Ratzeburg, 1929, sind drei Namensträger
von Reiche angegeben. Wer von diesen der "Modellerbauer" ist, bleibt
unerwähnt. Es ist jedoch anzunehmen, daß es der Stadthauptmann J. G.
G. E. von Reiche gewesen ist, den die Chronik auf Seite 63 in
anderem Zusammenhang "den talentvollen und stets spöttelnden,
vielseitig gebildeten, aber allzu selbstbewußten, damaligen
Ratzeburger Stadthauptmann von Reiche" nennt.
12) Masch, Seite 282.
Lbg. Heimat NF 64, Seite 16
Lbg. Heimat NF 64, Seite 17
sen sein, das in die Südwand der Vorhalle
eingebrochen wurde, und das in dem Dommodell von 1833 auf der Skizze
von Notz zu erkennen ist.
Fast zu gleicher Zeit wie in Ratzeburg begann der dritte Bau für den
Dom in Roskilde, Dänemark, auch er in Backstein. Er
wird um 1300 bis zum Westende vollendet worden sein. Später bekam er
mehrere Kapellenanbauten für Heilige
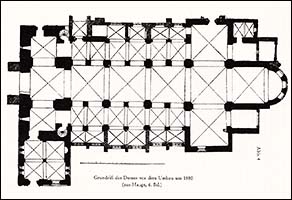
Abb. 4
Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880
(aus Haupt, 6. Bd.)
Lbg. Heimat NF 64, Seite 17
Lbg. Heimat NF 64, Seite 18
und vier Könige, zuletzt die schöne Vorhalle für den im Jahre 1485
verstorbenen Bischof Oluf Mortensen in norddeutscher Gotik. Der
reichgegliederte Giebel könnte sein Vorbild an profaner
Backsteinarchitektur etwa in Brandenburg oder Neubrandenburg haben,
der Unterbau dagegen an der Ratzeburger Vorhalle, nachdem sie ihr
großes gotisches Fenster bekommen hatte. Die Seiten sind vertauscht:
das weniger aufwendige Portal sitzt rechts, das Fenster links oben.
Das umlaufende Gesimsprofil ist aus der Sockelzone bis zu einer Höhe
von etwa 3 m emporgehoben und nun gleichzeitig Fenstersims geworden.
Aber es umläuft auch das Portal, das, wohl nicht so tief eingestuft
wie das Ratzeburger, doch im Innern und in der Tiefe rund, also noch
romanisch, geschlossen ist - Zugeständnis an das Vorbild in
Ratzeburg? -, während es in der Ebene der Vorhallenvorderfläche, der
Zeit folgend, spitzbogig überwölbt ist. Die Blende zwischen Spitz-
und Rundbogen ist geputzt. Als ich am 22. 6. 68 vor dieser Vorhalle
stand, sah ich das Vorbild Ratzeburg ganz deutlich vor mir (Abb. 5).
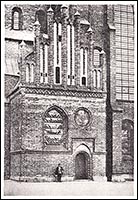
Abb. 5
Oluf Mortensens Vorhalle
Aus: Der Dom zu Roskilde
Bei der von Oberbaurat Daniel geleiteten und von Landbaumeister
Fr.
W. J. Rickmann durchgeführten Restaurierung der Jahre 1876 bis 1881
wurde die Mehrzahl der ab 1401 vorgenommenen Veränderungen wieder
rückgängig gemacht: die kapellenartigen Vorbauten wurden
abgebrochen, die Seitenschiffwände wieder an alter Stelle
geschlossen - die Lauenburger Kapelle blieb auf nachdrücklichen
Wunsch von Kaiser Wilhelm I. erhalten -, das große gotische Fenster
im Giebel des Querhauses wieder entfernt und das frühere romanische
Fensterpaar wieder angelegt. Auch das zweite Portal in der
Giebelwand der Vorhalle verschwand wieder und mit ihm die
Holztrennwände im Innern der Vorhalle. Leider hat Daniel nun die
Wand nicht zugemauert, sondern ihr in neuem roten Maschinen-
Lbg. Heimat NF 64, Seite 18
Lbg. Heimat NF 64, Seite 19
strichstein ein kleines romanisches Fensterpaar mit umlaufendem
Wulstprofil eingefügt, wie es sich in den beiden westlichen
Wandfeldern erhalten hat. Diese Lösung ist nach meinem Gefühl nicht
tragbar. Abgesehen davon ist sie bautechnisch so unglücklich
durchgeführt worden, daß das reiche Horizontalgesims an dieser
Stelle mit seinen beiden Stromschichten und dem Kreuzbogenfries
erheblich nachgesackt ist. Bei der Aufnahme der Staatlichen
Bildstelle Berlin mit den beiden Portalen zeigen sich diese
Gesimsversackungen noch nicht.
Der sehr feinfühlige Baumeister, der dieses Schmuckstück
Marienkapelle als "ein durchgestaltetes Kunstwerk" (Kamphausen)
unserem Dom um 1220 anfügte, hat seine sechs kleinen Fenster in drei
Fensterpaaren ziemlich hochsitzend - die innere schräge
Fensterbrüstung liegt etwa 3,50 m über dem Fußboden - in sehr
bescheidenen, also noch streng romanischen Abmessungen angeordnet,
zwei Paare an der Westfront, ein Paar im Osten. Die Apsis hatte
ursprünglich kein Fenster. Das wurde auch erst unter Daniel
eingebrochen. Das beherrschende Gestaltungsmotiv für ihn waren das
Portal mit der äußeren Mauervorlage und umlaufendem Randprofil -
wegen der Mittelsäule im Innern mußte der Eingang ja exmittig, d. h.
außerhalb der Mittelachse, aber in der Achse des inneren Domportals
sitzen - und das überreich geschmückte Giebeldreieck mit der
Blendrose, den dreiseitig umlaufenden Zierfriesen, den halbrunden
Lisenen und dem Mauergrund im Ährenverband. Zum Giebel sollte der
Blick geführt, nicht zu einem Fensterpaar abgelenkt werden, das in
der Wand sehr ungünstig sitzt: das horizontale Randprofil über dem
Portal schneidet in seiner optischen Verlängerung mitten in das
Fensterpaar, andererseits schneidet die Fensterbasislinie, nach
links verlängert, in das Portalhalbrund. Diese fatalen
Überschneidungen werden besonders deutlich, wenn man sich der
Vorhalle von halbrechts oder halblinks nähert. Man unterschätze
nicht den Mut des alten Baumeisters, der es wagte, in der
"Urfassung" neben dem einseitig angeordneten Portal eine glatte
Wandfläche zu zeigen und erst im architektonisch so reich
gegliederten Giebeldreieck die ausgewogene Symmetrie der spröden
backsteinernen Formenelemente zur vollen Harmonie zu bringen. Ich
habe mich seit Jahren mit diesem gestalterischen Motiv der
zurückhaltenden Portalwand im Untergeschoß und dem bekrönenden
Schmuckgiebel beschäftigt und finde keine bessere Lösung, als das
Fensterpaar auch außen zuzumauern, so wie wir es im Oktober 1966
nach mündlicher Zustimmung von Landeskonservator Dr. Beseler schon
im Innern geschlossen haben. Wir müssen den Mut aufbringen, auch
hier eine für die Gesamthaltung entscheidend wichtige
Wiederherstellung des Ursprünglichen vorzunehmen. Um so stärker wird
der dann gewonnene Eindruck auf uns wirken, wir werden überrascht
feststellen, daß damit "eine bisher unerkannte Monumentalität" im
Vorhallengiebel durchbricht. So ähnlich nannte ein von mir in seinem
Urteil geschätzter Fachkollege seinen Eindruck, als ich ihn vor
kurzem an Ort und Stelle von meiner Absicht unterrichtete. Wir
sollten uns außerdem von dem "horror vacui", der Scheu vor der
Leere, freimachen, uns aber gleichzeitig darüber klar werden, daß
unser Auge sich an unschöne architektonische Veränderungen leider
gewöhnt, ohne kritisch zu prüfen, zumal, wenn solche, wie in unserem
Falle, schon fast 90 Jahre alt sind. Ähnlich erging es uns, als wir
im Jahre 1958 die zweigeschossige Uhrarchitektur entfernten, die
Daniel im Jahre 1895 nach dem Dombrande "in den südlichen
Querschiffgiebel, der KAHL UND LEER (!) eine reichere Ausstattung
... sehr wohl vertragen kann" 13), einfügte.
Es gibt einige bevorzugte Standpunkte, von denen aus man eine
örtliche Überprüfung anstellen sollte: 1. Blick vom Palmberg, wobei
der rechte große Tor-
____________________
13) Aus dem "Vorwort zum Materialien- und Kostenanschlag zur
Wiederherstellung des im Jahre 1893 durch Brand beschädigten Domes
zu Ratzeburg".
Lbg. Heimat NF 64, Seite 19
Lbg. Heimat NF 64, Seite 20

Abb. 6a-d
4 Fotos: Wohlfahrt, Ratzeburg
Lbg. Heimat NF 64, Seite 20
Lbg. Heimat NF 64, Seite 21
pfeiler das Fensterpaar zudeckt (Abb. 6a). 2. Blick an der
Grenzlinie Kreismuseum-Domprobstei an dem Verbotsschild auf dem
Fußweg zum Patschengang. Hier übernimmt der Sockel des Löwendenkmals
die das Fensterpaar zudeckende Aufgabe (Abb. 6b). 3. Am Ausgang von
der Domprobstei zur nördlichen Rampenanfahrt, und zwar beim (nicht
vollständigen) Durchblick auf den Vorhallengiebel zwischen hinterer
Kante des Kreismuseums und vorderer Giebelschräge des
Organistenhauses. 4. Auf dem Domkirchhof von SO, wobei das
immergrüne Buschwerk der schönen Taxusgruppe die Fenster verdeckt
(Abb. 6c). 5. Schaut man sich den Giebel unter ganz flachem Winkel
von rechts oder links an, so wird die oben genannte überschneidende
Wirkung von Fensterbasis- bzw. Randprofillinie des umlaufenden
Portalgesimses besonders deutlich und beklemmend erkennbar (Abb.
6d).
Man wird fragen, warum wir nicht, als wir die Fenster innen
zumauerten, sie auch gleich außen geschlossen haben. Die Frage ist
berechtigt, und wir hätten dann heute schon die volle Wirkung des
Äußeren. Diese Frage stellte mir auch s. Zt. Domprobst Dr. Groß,
mein Bauherr. Ich erklärte ihm, daß wir keine Mittel mehr hätten, da
die Restaurierung von Sakristei und Vorhalle nicht gesondert ins
Bauprogramm aufgenommen worden war, sondern mit bescheidenen
Restmitteln begonnen, dann aber gestoppt werden mußte. Die Fenster
sind innen nur stumpf zugemauert worden. Dafür hatten wir noch eine
Anzahl guter alter Handstrichsteine. Außen hätten wir, auch zum
Ersatz der roten Maschinenstrichsteine in, unter und neben der
Fensterzone gute alte gelbliche Steine gebraucht. Die stehen uns aus
den inneren Turmwänden und aus den Innenwandflächen des Obergadens
unter den Seitenschiffdächern in genügend großer Zahl und Güte zur
Verfügung. Man braucht sie dort nur durch neue in gleichen
Abmessungen zu ersetzen. Die entscheidende BAUTECHNISCHE
Schwierigkeit, der wir uns gegenüber sahen, war jedoch die
beklagenswerte mangelhafte Standsicherheit des Giebeldreiecks. Bei
einem Blick von der Seite erkennt man mit erschreckender
Deutlichkeit, wie die Giebelspitze um mehr als 25 cm überhängt, und
wie sich die Basislinie mit Stromschichten und Kreuzbogenfries
beträchtlich nach außen gedrückt hat. Jede Stemmarbeit am Mauerwerk
in der Gefahrenzone verbot sich ganz zwangsläufig. Ein von mir noch
während meiner Amtstätigkeit erbetenes Gutachten über die Maßnahmen
zur Sicherung der gefährdeten Standfestigkeit wurde mir erst nach
meinem Ausscheiden aus dem Dienst zugestellt. Ich unterrichtete
davon das Kultusministerium und auf seinen Wunsch den
Landeskonservator. Ob für diese dringenden Sicherungsmaßnahmen -
Einbau eines Stahlbeton-Ringbalkens, Abbruch des gerissenen
Hintermauerungswerks und dessen sorgsame Wiederaufmauerung mit
Verankerung zum äußeren Verblendmauerwerk in Verbindung mit einer
Stahlkorsett-Konstruktion - Mittel bereitgestellt wurden und wann
das Landesbauamt die Arbeiten durchführen wird, ist mir, weil ich
davon nicht unterrichtet werde, unbekannt.
Zum Abschluß seien noch einige Bemerkungen über die Nutzung der
Vorhalle nach der Restaurierung von 1876/81 erlaubt. Rickmann
spricht in seinem Buch auf Seite 57: ,,. . . Eine etwas abweichende
Behandlung hat die südliche Eingangscapelle erfahren. Da sich hier,
namentlich in der Mittelsäule, grünglasierte Steine vorfanden, ist
bei der Decoration dieses Raumes die grüne Farbe mehr zur Geltung
gelangt, und wo die alten grünglasierten Steine nicht mehr vorhanden
waren, ist diese Glasur durch Farbe ersetzt worden. Sämtliche
Malereien sind nach Angabe des Bauraths Daniel von dem Maler
Rieckhoff in Ratzeburg ausgeführt worden."
Der Raum war recht farbig angestrichen, Gurtbögen und Gewölbegrate
bekamen Schablonenmalerei, die Pfeilervorlagen, Portal-, Apsis- und
Fensterrahmen
Lbg. Heimat NF 64, Seite 21
Lbg. Heimat NF 64, Seite 22
waren im Farbwechsel grün und gelb bzw. durchgehend rot gestrichen,
die Fugen, auch auf den Wandflächen, aufgemalt. Wohl war dem Raum
das Odium der "Materialienkammer" genommen, aber ein Kultraum war es
nicht wieder geworden. Was sollte man mit ihm in den Jahren des
"dunklen Zeitalters" anfangen? Man stellte den Abguß des
Braunschweiger Löwenstandbildes, den Großherzogin Auguste-Karoline,
eine englische Prinzessin, dem Dom zur Wiedereinweihung im Jahre
1882 und "zu Ehren und zum Andenken an ihren großen Ahnherrn
Heinrich den Löwen, den Stifter des Bistums und Erbauer des Domes"
geschenkt hatte, in ihm auf. Sinnigerweise stand er mit dem
Hinterteil vor der Apsisnische und ließ sich dieses durch das
Sonnenlicht bescheinen, das durch das eben erst neu eingebrochene
Apsisfenster hereinstrahlte! Man hatte jedes Wissen um sakrale Würde
und Aussagekraft verloren, sonst hätte man nicht gerade ein
Löwenstandbild in einen Kultraum gestellt, der vordem die
Marienkapelle war. Wir besitzen noch Aufnahmen von Dr. Stoedner,
Berlin, in den Büchern von Stiehl bzw. Kamphausen. Bei der ersten
verdeckt die Mittelsäule das Vorderteil des Vierbeiners, und neben
ihr sieht man noch einen Teil des inneren Kastenflügels vom
spätgotischen Wandelaltar, der, auf dem Fußboden abgestellt, sich
gegen die Wand lehnt. Bei der anderen blicken wir in die SO-Ecke des
Raumes, sehen vor der Wand, in der kurz zuvor noch das Pseudo-Portal
des "Feuerspritzen-Locals" saß, eine Sargtragbahre und sechs
Sargleuchter stehen.
Bis zum Jahre 1903 blieb der Löwe in der Vorhalle. Dann gab man ihm
den neuen Platz in der Mitte der südlichen Friedhofsmauer. Die
Eingangshalle wurde nun für den Gottesdienst im Winter "mehr
schlecht wie recht" 14) hergerichtet.
Für die 800-Jahr-Feier der Grundsteinlegung (11. 8. 1154), also am
11. August 1954, hatten wir vom Lübecker Landesbauamt in
Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalspflege, Leitung
Landeskonservator Dr. Peter Hirschfeld, ein kleines Bauprogramm
zusammengestellt. Es sah u. a. vor die Herabzonung der oberen, im
Jahre 1895 nach dem Dombrand vom 19. August 1893 aufgebrachten, über
1 m hohen Friesaufmauerung, die Wiedererrichtung des Dachreiters auf
der Vierung, seine und des Turmdaches Eindeckung mit Kupfer, vor
allem aber die Restaurierung der Vorhalle als Vorstudie zur
kommenden großen Restaurierung des Dominnern. Was wir da auf
gegebene Weisung durch die "hauchdünne Kalkschlämmung" der
Pfeilervorlagen und Wandfelder getan haben, hat sich leider als
Irrtum erwiesen. Wenn man altes Backsteinmauerwerk kräftig schlämmt,
ist es nicht zu schwer, diese Schlämme mechanisch und durch Säure
bzw. Lauge nach Belieben später wieder zu entfernen. Oft platzt sie
von selbst wieder ab (z. B. Marienkirche in Lübeck nach dem
Luftangriff und Brand vom März 1942). Eine hauchdünne Kalkung aber
geht mit der Backsteinoberfläche eine chemische Verbindung
(Calciumhydroxyd) ein. Unter Aufnahme von Kohlensäure wird der
andauernde Prozeß in der hauchdünnen Schlämmschicht verdichtet.
Wir haben nach dem Abschluß der Domrestaurierung und bis zu meinem
Ausscheiden aus dem Dienst verschiedene Versuche mit Säuren und
Laugen vorgenommen. Dank dem guten Rat von Bildhauer Harry Egler und
in Verbindung mit Malermeister Heinrich Liebe, beide in Bad
Oldesloe, haben wir zwei Probestreifen für die Entfernung der
"hochdünnen" Kalkschlämme angelegt, die sich bis heute ausgezeichnet
frisch gehalten haben und als voll gelungen bezeichnet werden
müssen. Sie werden uns helfen, die hoffentlich bald durchzuführende
Freilegung und Ausbesserung des Backsteinmauerwerks auch in der
Eingangshalle zu
____________________
14) von Notz, Seite 67.
Lbg. Heimat NF 64, Seite 22
Lbg. Heimat NF 64, Seite 23
beenden. Seit Beginn des kalten Wetters kann diese als Kultraum für
Morgen- und Abendandachten nicht genutzt werden. Wegen der
Umstellung auf Erdgas sind die drei Gasheizkörper nicht mehr zu
benutzen. Ob ihr Umbau möglich und wirtschaftlich ist, muß noch
überprüft werden.
Literaturnachweis
1. Das "Ratzeburger Zehntregister" von 1230 ("Register der von den
Bischöfen von Ratzeburg verliehenen Zehnten") aus Mecklenburgisches
Urkundenbuch, (M.U.-B) I. Band, 786-1250, Schwerin 1863.
2. G. M. C. Masch: "Geschichte des Bisthums Ratzeburg", Lübeck,
Friedrich Asschenfeldt, 1835.
3. Fr. W. J. Rickmann: "Die Domkirche zu Ratzeburg", Ratzeburg,
Verlag von Max Schmidt, 1881.
4. Stiehl, Otto: "Backsteinbauten in Norddeutschland und Dänemark",
Stuttgart 1923.
5. Haupt, Richard: "Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz
Schleswig-Holstein bzw. Geschichte und Art der Baukunst in
Nordelbingen", Heide in Holstein 1925.
6. von Notz, Ferdinand: "Der Dom zu Ratzeburg", Ratzeburg 1932.
7. Hellwig, L.: "Chronik der Stadt Ratzeburg", Lauenburgischer
Heimatverlag, Ratzeburg 1929.
8. Haupt, Richard: "Der Dom zu Ratzeburg" in "Kunst- und
Geschichtsdenkmäler des Freistaates Mecklenburg-Strelitz",
bearbeitet von Georg Krüger, Neubrandenburg 1934.
9. Haupt, Richard: "Die ältesten Dome und ihre Anfänge im Bereiche
der deutschen Nordmark", Westholsteinische Verlagsanstalt Heide in
Holstein 1936.
10. Schreiber, Hans Henning: "Der Dom zu Ratzeburg, acht
Jahrhunderte", Ratzeburg 1954.
11. Kamphausen, Alfred: "Der Ratzeburger Dom", Westholsteinische
Verlagsanstalt Boyens & Co., Heide in Holstein, 1954 und 1966.
12. F. Mollers und Sv. Pedersen, Roskilde: "Der Dom zu Roskilde",
Flensborg Verlag, Roskilde 1966.
|