|
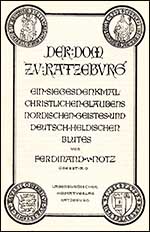
Mausklick ins Bild vergrößert die Darstellung!
Kapitel II: Der Dom.
Bedeutung und Bau.
Wir
durchschreiten den Ring alter Bäume und stehen staunend angesichts
des Domes. Umweht von den Schauern der Ewigkeit, umstrahlt vom
reinen Lichte des Himmels, liegt das hehre Gotteshaus da, gewaltig,
hoheitsvoll, ehrfurchtgebietend.
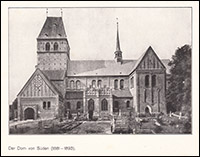
KUNSTGESCHICHTLICH betrachtet ist er das unübertroffene und
unübertreffliche Glanzstüclc früher nordischer Ziegelsteinbaukunst,
deren edelste und schönste Schöpfung. Fast unverfälscht ist er auf
uns gekommen. Die Schönheit seiner Kunstformen, bei all ihrer
Schlichtheit, packen den Beschauer nicht weniger als die Harmonie
des Ganzen, außen wie innen. Das Kirchenschiff ist, von wenigen
Zutaten aus späterer Zeit abgesehen, rein romanisch; die
Wissenschaft bezeichnet den Bau als dreischiffige, kreuzförmige,
steingewölbte Pfeilerbasilika. In dem spitzbogigen Gewölbe tritt der
Übergangsstil hervor. Drei der Portale, der Turm und eine noch
erhaltene Seitenkapelle, entstammen der frühgotischen Zeit. lm
Innern haben die späteren Stilarten bis zum Barock ihre Kunst
betätigt. Das Ganze - ein unvergleichlich herrliches Meisterstück
vaterländischer Kunst.
KIRCHENGESCHICHTLICH bedeutete der Dom einst den Mittelpunkt der
geistlichen Gewalten in den weiten
9
10
Landen
rundum; Sitz des Bischofs und eines klösterlichen Domherrnstiftes.
Er war Hort und Herd der göttlichen Heilslehre; die feste Burg des
Christengottes im Heidenlande. Er ist das Symbol des Triumphes des
Christentumes über das Heidentum.
ZEIT- UND KULTURGESCHICHTLICH ist er, der geboren ist in jener
gewaltigen Epoche, da sich das junge Deutschtum im Osten gründete
unter Strömen von Blut, Künder und Siegeszeichen einer höheren
Weltauffassung über eine verworfene, aber auch ein Denkmal
heldischen Geistes und deutscher Kraft und Siegesherrlichkeit beim
ersten Abschluß des Riesenkampfes des Germanen- und Slaventumes. Der
Markstein einer Weltenwende.
Immerdar soll der Anblick des Domes, kühn und trutzig, unser Herz
erheben zu Kraft und Hoffnung. Den fernsten Geschlechtern sei er
noch ein Mahnzeichen und ein Gebot zu echtem deutschen Treugelöbnis!
Baubeginn und Meister.
Eine
alte Urkunde, das Ratzeburger Zehntenregister von 1230, beginnt mit
der Erzählung der Domgründung. lm weiteren Verlaufe berichtet sie
von einem Gelübde Heinrichs des Löwen, das er ablegte, als er auf
seinem ersten Heereszuge nach Überschreitung der Elbe die erste
Nacht im Feldlager zubrachte: das umliegende Land, Pötrowe, heute
Pötrau, weihte er zum Zeichen der Besitzergreifung des Slavenlandes
durch die Deutschen Gott und der heiligen Jungfrau und schenkte es
der bald zu bauenden Kirche. Es gehörte zum ersten Besitze des
Domes.
An dessen Hauptpforte befindet sich eine alte schöne Steintafel.
Unter dem Pardel-Wappen Heinrichs steht, daß er, dux bavariae et
saxoniae, diese Ratzeburger Kathedralkirche an den dritten lden des
August (d. i. der 11. 8.) 1154 gegründet und geweiht habe.
5) Bald nach der Gründung muß der
Kirchenbau in Angriff genommen worden
_______________
5) An der Jahreszahl ist lange
herumgedeutelt worden. Neuerdings hat sie Prof. Rich. Haupt einfach
und überzeugend erklärt. Die Steintafel selbst entstammt
spätgotischer Zeit. sie trägt in Wappenform und Schriftzügen die
Merkmale der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
10
11
sein.
Helmold, der Zeitgenosse, der nicht ferne wohnte und seine Chronik
im Jahre 1170 etwa beendete, berichtet (Kap. 91 S. 190): "Zu Zeiten
Heinrichs (von Bodwide) ward im Lande der Polaben ein Gotteshaus
gegründet, zu Zeiten Bernhards aber, seines Sohnes, wurde es sehr
großartig ausgeführt." Es kann sich nur um unseren Dom handeln; ein
unumstößliches Zeugnis.
Und wer war der Künstler, der Baumeister, der dies vollbrachte? Sein
Name ist nicht auf die Nachwelt gekommen. Es muß genügen, daß
Bischof Evermod, wenn er nicht selbst den Bau leitete, unter seinen
Mönchen Werkmeister und Helfer fand. Denn in jener mittelalterlichen
Zeit wurden Wissenschaft und Kunst - sie war ja fast ausschließlich
Kirchenkunst - in den Klöstern geübt. Nach Evermods Tode 1178 wird
sein Nachfolger, lsfried, tätigen Anteil genommen haben. Er war
Propst zu Jericho[w] in der Mark gewesen. Hier war bereits 1149-52 von
Prämonstratensermönchen eine Klosterkirche erbaut worden. Sie ist
anerkannt als das Muster romanischer Ziegelbaukunst der
norddeutschen Tiefebene. Manches aus ihr scheint beim Bau in
Ratzeburg zum Vorbilde gedient zu haben.
Vorbild und Plan.
Ein
wichtiger Merkstein in der Entwicklungsgeschichte des romanischen
Stils in Sachsen ist die Benediktiner-Klosterkirche St. Peter und
Paul zu Königslutter, unfern Braunschweig (Dehio V S. 296). 1135
wurde sie von Kaiser Lothar gegründet; er wurde bereits 1137 in der
Kirche beigesetzt, wenig später auch des Kaisers Gemahlin und sein
Schwiegersohn, Heinrich der Stolze, der Vater Heinrichs des Löwen.
Mit dieser Kirche haben die drei bald darauf von Heinrich dem Löwen
gebauten Kirchen, in Ratzeburg seit 1154, in Lübeck seit etwa 1160
und in Braunschweig seit 1173 eine vielbemerkte Ähnlichkeit. Das
beweist auch das Kirchenabbild, welches Heinrich auf seinem
Grabstein im Braunschweiger St. Blasiusdome im Arme hält.
Die verschiedenartige Fortentwicklung dieser Bauten im Laufe
späterer Jahrhunderte hat die Übereinstimmungen nicht zu verwischen
vermocht. Vor allem im Ratzeburger Dome ist der Einfluß der
hochentwickelten sächsischen Bau-
11
12
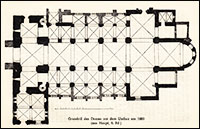
Grundriß des Domes vor dem Umbau um 1880
(aus Haupt, 6. Bd.)
12
13
kunst
allenthalben bemerkbar. So gilt als feststehend, daß der Plan aus
dem Braunschweigischen kam. Und die Werkmeister, in sächsischer
Kunst geschult, fühlten sich auch in Ratzeburg trotz des gänzlich
anderen Baustoffes an die herkömmliche Art gebunden. Viele
Einzelheiten finden dort ihr Gegenstück (so z. B. die Gewölbe in
Melverode. Nach Haupt).
Ein Unterschied im Plane bestand allerdings von Anfang an: der
Ratzeburger Dom ist um ein quadratisches Joch kürzer als die
anderen. Das beruht aber wohl nicht darauf, daß etwa bei ihm von
Anbeginn an mit geringerem Zustrom gerechnet wurde, sondern darauf,
daß der Platz für ihn auf dem Hügelrücken, auf dem er zu stehen kam,
beschränkt war. Nach feststehendem Grundsatze wurde die Kirche so
gerichtet, daß der Chor mit den Heiligtümern ostwärts wies.
Kreuzförmig schließen sich an das Mittelquadrat der "Vierung" nach
Ost das Chorquadrat mit der Concha (= Muschel, das ist die halbrunde
Absis), nach Nord und Süd die Querschiffquadrate und nach West die
drei Langschiffquadrate an. Letzteren sind nach Nord und Süd je drei
halbe Seitenschiffquadrate längs und nach West drei ganze
Turmschiffquadrate quer angeschlossen. Da, des Hügelabfalles wegen,
westwärts des Turmschiffes kein Raum und Zuweg für eine
Eingangshalle - das "Paradies" - und eine Hauptpforte war, wurden
solche südwärts, dem Palmberge zu, vorgebaut.
Der umfangreiche Bau mußte abschnittsweise erwachsen. Die ältesten
Teile sind das Vierungsquadrat, Chor und Querschiff. Nach
glaubhafter Überlieferung des Peträus (S. 48) müssen diese Teile
bereits zu Evermods Lebzeiten unter Dach gewesen sein. Er soll 1172
des Heiligen Ansver Gebeine, die durch ein Wunder von einem Blinden
im nahen St. Georgsberger Kirchlein aufgefunden worden waren,
feierlich und mit großem Gepränge in den Dom überführt haben. Auch
ist Evermod selbst im südlichen Querschiffe beigesetzt gewesen, wie
aus der ursprünglichen Lage seines Grabsteines geschlossen werden
kann.
Dann
werden das Turmschiff und das mittlere Langschiff in Angriff
genommen worden sein. Der jüngste, aber auch schmuckvollste Teil des
Baues, ist die Eingangskapelle. Unbestätigte Sage schrieb sie dem
Bischof
13
14
Evermod
zu. Vielleicht verweisen Ähnlichkeiten mit der Jerichower Kirche, so
vor allem der schöne Vierpaßpfeiler in der Mitte der Kapelle, auf
den zweiten Bischof Isfrid, der, wie wir wissen, aus Jerichow kam.
1220 etwa, also noch in romanischer Zeit, war die Kirche in ihren
Hauptteilen vollendet. Ihre ursprüngliche Gestalt hat sie bis zum
Ende des 14. Jahrhunderts« bewahrt. 6)
Der TURM ist jünger als der eigentliche Dom. Die Schwesterkirchen
alle weisen zwei Türme auf. Auch für unseren Dom waren zwei geplant.
Ihre Schäfte, mit romanischen Fenstern aus der ersten Bauzeit, sind
noch vorhanden und reichen bis zur Höhe des Kirchendaches. Aus
irgendwelchem Grunde wurde der Plan geändert; in frühgotischer Zeit
wurde auf den lnnenmauern der beiden Stümpfe der breite massige und
doch wirkungsvolle Einzelturm aufgeführt, der heute noch nach
mancherlei Schicksal dem Ganzen zur würdigen Krönung dient.
7) Früher öffnete sich der Turm in
einem schönen, großen gotischen Fenster. Erst in jüngster Zeit,
1895, ist es der Orgel wegen beseitigt worden. Gotisch sind auch
heute noch von den sechs Kirchenpforten drei, von denen allerdings
zwei zugemauert sind. Seit 1370 entstanden nacheinander längs der
Seitenschiffe zwei Reihen niederer gotischer Seitenkapellen. Von
ihnen steht heute nur noch die sogenannte Lauenburger Chorkapelle.
Von ihr wird noch die Rede sein (S. 64 und 72). Noch 1416 vermacht
Probst Nicolaus Rambow 100 Mark zum Bau einer neuen Kapelle
letztwillig.
_______________
6) Zu den ältesten Teilen des Domes
gehört unstreitig der kleine Bau zwischen der nördlichen
Chorseiten-Kapelle und dem Kapitelgebäude. Der untere Raum, der mit
der Kirche in Verbindung steht, ist heute Sakristei. Der obere wird
ehedem die
"Trese", d. i. "Gerwet- oder Schatzkammer" gewesen sein. In ihr
wurden die Kleinodien und die wertvollen Urkunden des Domes und des
Stiftes aufbewahrt. Über eine merkwürdige akustische Verbindung
dieses Raumes mit dem Dome, von dem er durch dicke Mauern getrennt
ist, wurde im Aprilhefte 1930 der "Lauenburgischen Heimat" unter
"Domgeschichten: Das Ohr des Dionys" berichtet.
7) Nach einer Urkunde von 1284 schenkte
Bischof Conrad die Hälfte von Zodenitze zum Bau des Domes. Da dessen
Hauptteile sowie der Klosterbau bereits fertig waren, mag es sich
bei der Schenkung um die Bestreitung der Kosten des Turmbaues
gehandelt haben. Eine Urkunde von 1347 spricht ausdrücklich von
"restauratio turris."
14
15
Die
Fantasie einer späteren Zeit hat sich mit dem ersten Dombau
beschäftigt. Bothos niederdeutsche "Chroniken der Sassen", unsere
älteste gedruckte Bilderchronik, von 1492, hat ein Bildchen davon,
an dem wenigstens das Wappen des "Bischopp van Rosseborge" richtig
ist.
Baustoffe.
Dem
Dombaumeister auf der entlegenen lnsel in dem eben erst eroberten,
noch nicht befriedeten Feindlande mußten weit größere
Schwierigkeiten erwachsen, als wie es in den altsächsischen Landen
der Fall gewesen. Dort standen Kunst und Bauwissenschaft seit
Jahrhunderten in hoher Blüte; dort stand auch bester Haustein zur
Verfügung als alterprobter Baustoff. Nichts von alledem im
Wendenlande. Hier war bisher der Steinbau unbekannt. Jeder
Bauhandwerker, alle Hilfsmittel mußten erst von weither herangeführt
werden. Und der eigentliche Baustoff, der Stein, mußte erst
künstlich geschaffen werden. Findlingsgranit fand sich zwar genug
auf den Feldern. Doch der war damals noch zu schwierig zu
bearbeiten; nur zu rohem Grundsteinbau ward er geschichtet. Ganz
jung erst war die Erfindung der Ziegelbaukunst der anzuwendenden
Art. Noch lebten Vicelin, der Bischof von Oldenburg, und Volchart,
sein Baumeister, welchen das Verdienst zugeschrieben wird. (Nach
Haupt, "Ziegelbau".) Um so bewundernswerter ist die Makellosigkeit
des Baustoffes wie die Tadellosigkeit des Bauens.
Auf dem St. Georgsberge liegt heute "Neuvorwerk". Die alten Urkunden
nennen es "siccum allodium" = "das Drogen-Vorwerk". Hier ward der
dröge (trockene) Lehm zum Ziegelstein gebrannt.
8) Auf der anderen Seite des Sees liegt
heute noch "Kalkhütte". Der Muschelkalk von dort mag dem ersten
Dombau gedient haben, bis, in späteren Jahrhunderten, gebesserte
Land- und Wasserstraßen die Heranführung von Segeberger Kalk
gestatteten.
Der zuerst angewandte Ziegel in grau-gelblicher Tönung ist von einer
später nie mehr erreichten Güte, Festigkeit und Schönheit. später
wird der Stein rötlicher und immer weicher. An der Güte und Färbung
der Steine
_______________
8) Auch der Lübecker Dom bezog seine
Ziegel aus einem "Drogen-Vorwerk", das sich bei Lübeck befand.
15
16
läßt
läßt sich mit ziemlicher Sicherheit das Alter des Bauteiles
ablesen. Baumeister Rickmann (1881) erzählt, das älteste Mauerwerk
sei von solcher Festigkeit, daß Änderungen am Baukörper eine sehr
mühsame und zeitraubende Arbeit bedeuteten. Der Kalkmörtel band so
fest, daß sich die Fugen nicht lösen ließen und eher die Steine in
Trümmer gingen.
Bei den erstangewandten Steinen, besonders den Formsteinen, fällt
eine eigenartige Scharrierung oder Riefelung ins Auge. Man hat
geglaubt in ihr eine nachträgliche Behauung des gebrannten Ziegels
zu erkennen. Man suchte das sogar damit zu begründen, daß ja die
Werkleute aus dem Hausteinlande gekommen seien und die
Steinbearbeitung mit Hammer und Meißel für sie unerläßlich gewesen
sei. Die Riefelung ist aber sichtbarlich bereits am nassen Batzen,
vor dem Brennen erfolgt, wobei die gewünschte Form durch Stechen
mittels gezahnten Messers erreicht wurde.
Andere Eigenarten unseres Domes gegenüber den gleichaltrigen
Baudenkmälern des deutschen Ostens sind das Fehlen von Steinsäulen
und von Stuck. Letzterer ist erst spät und in bescheidenem Maße
angewandt worden. Knappheit der Geldmittel und Abneigung sollen
bestimmend gewesen sein. Doch will es eher so scheinen, als habe
sich der Baumeister stolz bestrebt, sein Werk einheitlich aus dem
ihm allein an Ort und Stelle zur Verfügung stehenden Stoffe zu
schaffen. Das zeigt sich in der außerordentlich mannigfachen Formung
der Steine an Pfeiler-Ecken und Kanten, an Tor- und
Fensterleibungen.

Nicht im
Artikel, hinzugefügte Abbildung!
Foto: Privatarchiv hom.
Nur zwei Paar verkuppelte Ziegelsteinsäulen weist der Bau auf in den
reizvollen romanischen Doppelfenstern, die von den Querschiffarmen
sich nach den Dachräumen der Seitenschiffe öffneten, heute aber
vermauert sind. 9) Für die Güte der
Arbeit zeugt auch der sehr ordentliche Mauerverband, der kein
Füllwerk kennt.
_______________
9) Diese sonst wohl kaum angewandten
lnnenfenster haben ihr Vorbild in der Ruine der Klosterkirche zu
Hersfeld, die 1043 erbaut wurde. Welchen Zweck mögen diese Fenster
gehabt haben? Vielleicht sollten sie die Beiwohnung der Messe denen
ermöglichen, welche die Kirche nicht betreten durften, sei es daß
sie sich im Kirchenbanne befanden, sei es, daß ihnen wegen
Krankheit, Aussatz, der Eintritt verwehrt war.
16
17
Außenschmuck.
Der
Außenschmuck des Domes beschränkt sich auf die Ausgestaltung der
Tore und Fenster durch Rundsäulchen. Die Leibungen der Tore sind
abgetreppt. Die Wandflächen werden belebt von Lisenen - das sind
halbrunde Wand- und Pfeilervorlagen -, sowie durch Friese, die den
oberen Kanten folgen. An der Chor-Absis, sind sie einfach rundbogig,
an anderen weniger beachteten Stellen rautenförmig, in der Hauptsache
aber kreuzbogig. 10) Reich sind die
Giebel ausgestattet, besonders der der Eingangskapelle. Vom
Gurtgesims steigen hier neun Lisenen auf. Eine Kreisrosen-Blende und
über dieser ein kleines offenes Kreuz füllen das Giebeldreieck, das
wiederum von schräg aufsteigendem Kreuzbogenfries eingefaßt ist. Die
ganze Wandfläche ist von aufwärtslaufenden Zickzackstreifen
verblendet.
Außen scheint der Dom stets Rohbau gewesen zu sein. Nur die kleinen
Felder zwischen den Friesen und zwei schüsselförmige Rundungen, in
welche die Lisenen des südlichen Querschiffes auslaufen, sind weiß
verputzt.
Das Innere.
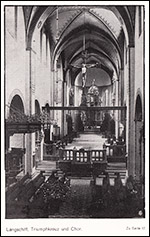
Sinn
und geistiger Inhalt einer Religion suchen sich zu verkörpern in
religiösen Bauten, in Tempeln und Kirchen. Von der Erhabenheit des
Gottesgedankens zeugt schon äußerlich der gen Himmel ragende Bau.
Die lnnigkeit des Glaubens deutet das lnnere an, voll Feierlichkeit
und Sehnsucht, voll ernstem Streben, aber auch fröhlicher Hoffnung;
streng und doch liebe- und verheißungsvoll. Strahlendes Licht
durchflutet warm und hell den ernsten Raum. Goldig, verklärend ruht
es auf dem Symbol der sich für die Sünden der Menschheit opfernden
Liebe Gottes, auf dem Kreuze des Erlösers ln unserem Dome herrscht
kein Dämmerlicht, wie sonst so oft in alten Kirchen. Ein Meer von
Licht flutet durch die zahlreichen Fenster.
__________________________________
10) In der nördlichen Ecke zwischen
Chor und Querschiff sind vier verschiedene Friesarten unauffällig
nebeneinander gestellt. An dieser entlegenen Stelle scheint der
Baumeister erprobt zu haben, welches Muster seinem Werke am besten
anstehen würde. Nebenbei ist dies wohl auch ein Beweis dafür, daß
diese Bauteile zu den ältesten gehören.
17
18
Das
Bauliche zeigt im Innern bei aller Harmonie des Ganzen ein stetes
Wechseln der Formen; kaum eine Einzelheit, die der anderen gleicht.
Eine erstaunliche Beweglichkeit lebhaften Erfindergeistes, der immer
neue Spielarten ersann. Eine wunderliche Lust der Abwechselung.
(Nach Haupt, "Ziegelbau".)
Der lnnenraum hat noch die Einteilung der katholischen Kirche: Der
westliche, untere Teil gehört der Laienwelt, der andere, erhöhte,
von ihm durch die hohe Chorschranke getrennt, der Geistlichkeit.
Letzterer war wiederum zweigeteilt. In dem niederen Chor hatten die
Domherren ihr Gestühl. Der östliche Teil mit der Koncha, der hohe
Chor, enthielt den Hochaltar. Der hohe Chor war dem Bischof und
seinen Statthaltern beim Hochamt vorbehalten; ihn zieren die
"Levitenstühle" heute noch.
Es fällt auf, daß der Chor so außergewöhnlich hoch über dem
Laienschiffe liegt. Sieben Stufen führen zu ersterem empor. Das war
nicht immer so. Erst um 1520 ist dies entstanden, als die heute noch
vorhandenen Fürstengrüfte unter dem Chore angelegt wurden. (S. 43.)
Die Gewölbe.
Im
lnnern zeigen die Seitenschiffe rein-romanische Rundbogenwölbung
Auch der Gurtbogen der Absis ist rund. Im Gegensatz dazu sind Haupt-
und Querschiffe überdeckt von einem langen, schwach-spitzbogigen
Kreuzgewölbe in Form einer Tonne, in welches Stichkappen
einschneiden. Darunter sind starke Steingurte gezogen, die
gleichfalls spitzbogig sind. Hierdurch ist die Meinung entstanden,
die Hauptgewölbe seien erst in spätmittelalterlicher Zeit gebaut.
"Es wird erzählt", sagt G. C. F. Lisch (in "Mecklenburg in Bildern"
VIII. Heft, 1842), "Bischof Johannes von Parkentin, der von
1479-1511 regierte, habe den mittleren Gang der Kirche, der früher
mit den Nebengängen gleiche Höhe gehabt habe, so hoch hinauf gebaut,
wie er jetzt ist, und die nach den Spitzbogen geformten Gurtbogen
der Gewölbe scheinen die Sage zu bestätigen. 11)
__________________________________
11) Die seit 1457 vorhandenen
Strukturs-Register des Domes geben keinerlei Auskunft über solch
späte Erhöhung des Mittelschiffes.
18
19
Baumeister Rickmann (S. 49-51) glaubte dem beipflichten zu müssen.
Es ist nicht glaublich, ein gotischer Baumeister des 15./16.
Jahrhunderts habe einen bedeutenden Bauteil - den Obergaden
- romanisch, wie dieser heute noch steht, dazu noch mit den alten
Steinen des 12./13. Jahrhunderts, ausgeführt. Das beweisen alle
nicht mehr romanischen Teile späterer Zeit am Dom. Es ist wohl
denkbar, daß in der ersten Bauzeit eine Balkendecke vorübergehend
bestanden hat, ehe das Gewölbe durchgeführt war. Das findet sich
heute noch in alten, romanischen Kirchen. Gleichen Gewölbebau wie
der Ratzeburger zeigt auch der ihm so nah verwandte Braunschweiger
Dom, von dem wir genau wissen, daß er 1195 vollendet war. Dabei ist
zu bedenken, daß sich in jener ersten Bauzeit die Formensprache und
Technik der Baukunst bereits abzuwandeln begann in jenen Stil, der
als "Übergangsstil" bezeichnet wird und zur Frühgotik hinüberleitet.
Vertrat schon Architekt Lauenburg die Ansicht von der ursprünglichen
Echtheit der Gewölbe, so hat letzthin Prof. Haupt eingehend
bewiesen, daß Zweifel unberechtigt sind. Dehio (II, S. 396 ff.) sagt
hierüber: "Das scharfkantige Kreuzgewölbe, von derben Gurten
getrennt, auf Schalung gemauert, in den Abseiten rundbogig, im
Hochschiffe spitzbogig, so daß seine Vollendung gegen 1220
anzusetzen ist." Es ist dabei eigentümlich, daß die groben breiten
Gurtbögen, die das Gewölbe zu tragen scheinen, dazu keineswegs
dienen. Beide sind unabhängig von einander und nur oberflächlich mit
einander verstrichen. Das Gewölbe setzt da aus, wo sich Gurten
befinden.
In dies Fragengebiet schlägt noch eine andere, viel beachtete
Seltsamkeit des Domes: Einer der hohen Arkadenbögen - es ist der an
das Turmschiff anstoßende der südlichen Reihe zeigt im Gegensatz zu
allen anderen, rein rundbogigen, den Spitzbogen. Er mußte hier wohl
oder übel zur Anwendung kommen. Die einzelnen Teile des Grundbaues
waren ja nicht in zeitlichem Zusammenhange entstanden. Dabei hat
sich der Baumeister offensichtlich im Grundrisse um ein weniges
verrechnet. Der Pfeiler-Zwischenraum war hier zu schmal geworden.
(Gleiches ist auch anderen Orts beobachtet; in Ringstedt auf Seeland
und in zwei Bogen sogar zu Marienberg bei Helmstedt; siehe Haupt VI,
62.)
19
20
Das
Gewölbe hat nicht nur dem Drucke vieler Jahrhunderte und den
dänischen Bomben 1693 widerstanden, sondern es hat auch einer
gefährlichen Feuerprobe getrotzt. Als Turm und Kirchendachstuhl
infolge Blitzschlages 1893 völlig aus- und abbrannten, widerstand
das Gewölbe. Das Kirchen-Innere mit seinen Kunstwerken ist dadurch
unversehrt bewahrt geblieben.
Die Bedachung, heute aus Schiefer und Ziegel, bestand früher, von
alters her, aus Blei und teilweise aus Kupfer. Mehrfach stoßen wir
in den alten Strukturregistern des Domes auf den "Blidecker uth
Lübeck", der mit "Rollblei" das Dach zu erneuern hat, und auch auf
den "Kannengeter oder Beckenschlager" von Ratzeburg, welche Löcher
im Dache zuzulöten haben. Im Jahre 1537 geschieht bei solchen
Dacharbeiten eines Tönnies KLOPSTOCK Erwähnung, eines ehrsamen
Handwerkers, wie es scheint, des ersten bisher bekannt gewordenen
Vorfahren des Sängers des Messias. -
Zusammenfassend urteilt Haupt: "Überblickt man das Ganze, muß man
staunen über die Untadeligkeit der Technik. Wo ist sonst ein so
großer Bau, der so fest auf seinen Füßen stünde, ohne viel Risse und
Spalten zu zeigen, sich 1/2 Jahrtausend und mehr im Wesen erhalten
hätte? Und dieser ist nicht aus Naturstein, sondern der schlechten
erdigen Masse abgewonnen, aus der erst Steine haben gemacht werden
müssen."
Name und Weihe.
Heinrich der Löwe hatte das Gelübde getan, den Dom der Mutter Gottes
zu stiften. Geweiht wurde er der Jungfrau Maria und dem Apostel
Johannes. Beider Bilder aus ältester Zeit stehen heute noch unter
dem großen Triumphkreuze. Das älteste erhaltene Kirchensiegel - von
1210 - zeigt das einfache Marienbildchen mit der Umschrift: "Sigill.
Sancte Marie Virginis in Raceburg." Ursprünglich scheint auch der
Dom den Namen nach der Gottesmutter geführt zu haben. Eine Urkunde
von 1261 nennt ihn "ecclesia sanctae Mariae in Raceburg".
Später erst
wurde die ganze Kreuzigungsgruppe in das Wappen aufgenommen.
Jedenfalls genoß die Jungfrau höchste Verehrung. Feierliche
Handlungen, so bei Abtretung des Landes Boitin durch die
jugendlichen Herzöge von Sachsen,
20
21
finden
vor dem Bilde der heiligen Jungfrau am Hochaltar statt. Der
Marienkult stand dauernd in Blüte. 1350 stiftet Bischof Volrad ein
großes silbernes Marienbild. Im 15. Jahrhundert erhielt der Dom
mehrere große holzgeschnitzte Bildwerke der Jungfrau, die sich
erhalten haben. Noch 1501 wird in die Eidesformel der Bischöfe
aufgenommen, "den Mariendienst aufrecht zu erhalten", und 1509 stiftete Bischof
Johann von Parkentin Horen zu Ehren der Jungfrau in der Kapelle des
heiligen Martinus; auch wird dem Altar der Maria im Eingang des
Domes ein Benefizium gestiftet. Der Name Mariendom oder
Liebfrauenkirche hat sich allerdings nicht durchgesetzt.
|
Maßangaben. |
| |
|
|
|
Länge des Hauptschiffes ohne die Mauern |
|
60,57 m |
|
Ganze Länge der Kirche mit den Mauern |
|
64,44 " |
|
Länge des Hauptschiffes bis zum Querschiffe |
|
37,17 " |
|
Breite des Hauptschiffes |
|
8,28 " |
|
Breite des Querschiffes |
|
8,28 " |
|
Länge des Querschiffes mit den Mauern |
|
31,37 " |
|
Breite der Seitenschiffe |
|
4,28 " |
|
Ganze Breite der Kirche mit der Kapelle, einschließlich
der Mauern |
|
29,43 " |
|
Breite der Kirche ohne die Kapelle |
|
22,57 " |
|
Größte Höhe des Hauptschiffes |
|
17,29 " |
|
Größte Höhe der Seitenschiffe |
|
8,28 " |
Ganze Höhe der Kirche vom Fußboden
bis zum Dachfirst |
|
26,00 " |
|
Höhe des Hauptschiffes bis zum Hauptgesimse |
|
15,16 " |
|
Höhe des Kruzifixes über dem Chor |
|
5,71 " |
|
Turmhöhe etwa |
|
48,00 " |
____________________________________________________
Hier die
Vorlage der Transkription der Seiten 8-21, auch zum Download:

|
![]()